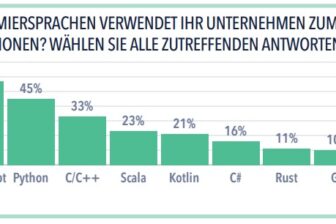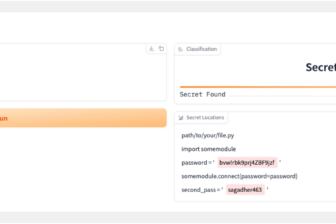So wandert Exchange in die Cloud
26. August 2011
Der Themenbereich um Exchange ist eine der drei Säulen, auf denen die Veranstaltung „The Expert Conference 2011“ (TEC 2011) basiert. Experten aus aller Welt treffen sich hierzu vom 17. bis zum 19. Oktober 2011 in Frankfurt, um den Konferenzteilnehmern die umfassende Funktionalitäten der Exchange-Umgebung zu vermitteln. Als Top-Experte im Exchange-Bereich wird Tony Redmond in seiner Keynote den Ausblick geben, wie sich die „Cloud-Orientierung“ bei Microsoft für die Anwender von Exchange auswirken wird.
Im Vorfeld der Veranstaltung gab Tony Redmond uns ein Interview. Darin erklärt der Exchange-Guru, für welche Unternehmen der Einsatz "Exchange aus der Cloud" sinnvoll erscheint und welche Implikationen ein hybrider Ansatz (Teile der Exchange-Infrastruktur laufen im Unternehmen, ein Teil wird aus der Cloud bereit gestellt) nach sich zieht.
Auf der Plattform NT4ADMINS im Online- und im Print-Bereich hat Tony Redmond zu Exchange bereits einige Beiträge publiziert. Nun kommt dieser Exchange-Experte zur TEC 2011 nach Deutschland und steht im Vorfeld der Konferenz uns zu Themen um Exchange Rede und Antwort.
Frage: Viele Unternehmen haben noch Exchange Server 2003 oder 2007 in ihrer IT-Umgebung im Einsatz. Wenn sie nun aktualisieren müssen, stehen zwei Wege offen: Zum einen können sie auf der Basis von Windows Server 2008 Release 2 und Exchange Server 2010 (Servicepack 1) migrieren oder aber sie verwenden das neu vorgestellte Office 265. Was würden Sie kleinen, mittleren oder großen Unternehmen empfehlen?
Tony Redmond: Hier gilt es zwischen zwei Gruppen von Anwendern zu unterscheiden. Wer noch mit Exchange 2003 arbeitet, der sollte sich Office 365 – oder auch einen anderen Hosting Provider für Exchange – sehr genau ansehen. Denn für dieses Klientel wird es einfacher sein, die Exchange-Umgebung aus der Cloud zu beziehen, als auf Exchange 2010 zu aktualisieren. Kleine und mittlere Unternehmen, die die Mailing-Funktionalität nicht als ihre Kernkompetenz betrachten, sollten einen besseres Service bekommen, wenn sie über einen externen Provider für Exchange gehen anstelle Exchange 2010 selbst im eigenen Haus zu betreiben. Natürlich gibt es bei dieser Regel auch Ausnahmen – vor allem wenn ein Unternehmen der Cloud nicht vertraut oder wenn andere Argumente dafür sprechen, dass die Mails im eigenen Haus bleiben sollen.
Wer dagegen heute schon Exchange 2007 verwendet, für den sieht die Sache anders aus. Zum einen sind sie nicht einem so hohen Migrationsdruck ausgesetzt, weil der offizielle Support für Exchange 2007 noch einige Jahre geliefert wird. Und zum zweiten haben sie bereits die nötigen Änderungen in der Mailing-Architektur unternommen – denn sie haben den Schritt von Exchange 2003 zu 2007 bereits vollzogen. Der Umstieg auf 2010 wird für diese Unternehmen daher viel einfacher. Des weiteren – und das ist der dritte Punkt in dieser Argumentationskette – verwenden sie Hardware, die relativ neu ist und die in der Regel nicht ersetzt werden muss. Daher werden Exchange-2007-Anwender nicht so schnell auf Office 365 wechseln.
Große Unternehmen sind wieder ein Fall für sich. Denn bei ihnen stehen üblicherweise weitaus komplexere Aufgabenstellungen im Bereich des Mailings an, die ein Dienst aus der Cloud unter Umständen gar nicht erfüllen kann. Zudem will man bei Microsoft so schnell noch keine dezidierteren Versionen von Office 365 anbieten, die einen höheren Spezialisierungsgrad erlauben. Aber die höhere Komplexität erfordert auch eine längere Vorlaufzeit für die Planung. Daher könnten diese Unternehmen heute schon beginnen und die Standardmöglichkeiten umsetzen und dann darauf warten, dass mit späteren, flexibleren Varianten von Office 365 mehr Anpassungen machbar sind.
Frage: Wenn ein Unternehmen sich zu einem hybriden Ansatz entscheidet, sprich es betreibt einen Teil der Exchange-Postfächer im Rahmen der eigenen IT-Umgebung und einen anderen Teil als eine Office-365-Lösung, welche Probleme entstehen dabei?
Tony Redmond: Ich denke, dass man bei einer hybriden Umgebung nicht von Problemen für die Administratoren sprechen kann. Vom Prinzip her ist ein hybrider Ansatz immer eine komplexere Konstellation, denn er nutzt Cloud-Komponenten und lokale Bestandteile. Administratoren stehen dann eben vor der Aufgabe, diese unterschiedlichen Komponenten zu synchronisieren, um einen nahtlosen Dienst für die Benutzer bereitzustellen. Sie sollen nicht merken, woher der Service letztendlich kommt. Doch andererseits wird durch das Vergeben von Arbeitslast nach außen – sprich zum Exchange-Betreiber – auch wieder Freiraum geschaffen. Der sollte ausreichen, um diese Synchronisationsaufwände abzudecken.
Frage: Die Entscheidung zwischen den Ansätzen„Verwenden sie Cloud Services“ oder „Setzen sie Exchange 2010 im eigenen Haus ein“ wird in vielen Fällen durch die gesamten Kosten für die Lösungen entschieden. Wie können Tools von Drittherstellern den Unternehmen helfen, die Exchange im eigenen Unternehmen betreiben wollen, damit sie ihre Exchange-Umgebung effizienter betreiben können, als das allein mit den Bordmitteln von Exchange möglich ist?
Tony Redmond: Bei der Kostendiskussion darf man nicht vergessen, dass es dabei um weit komplexere Zusammenhänge geht als nur "Kosten pro Postfach pro Monat". Hier sind auch noch andere Faktoren einzurechnen, wie etwa das Netzwerk, die Server-Hardware und die Speichersysteme sowie der Aufwand für die Systemverwaltung – sprich die Arbeitskosten. Jeder der sich mit dem Auslagern in die Cloud befasst, sollte zuerst unbedingt ein umfassendes Verständnis der Kostenstrukturen besitzen. Erst dann kann man überlegen, wo zu sparen ist und wo man unter /Umständen mehr Geld ausgeben muss.
Angenommen die Netzwerk-Infrastruktur, die in den meisten Unternehmen zum Einsatz kommt, ist vor allem nach innen gerichtet. Denn das ist auch die Art und Weise, wie Benutzer auf die IT-Dienste zugreifen. Verschiebt man dagegen Anwendungen in die Cloud, ändert sich das Bild: Mehr Netzwerkverkehr kommt von außen – über die Internet-Anbindung – in das Unternehmen. Das muss man in seiner Infrastruktur auch berücksichtigen. Die Überwachung, die Support-Aufgaben und das Überwachen der Service Level Agreements bereiten dann mehr Aufwand – und das zieht Kosten nach sich.
Chancen für Dritthersteller von Software ergeben sich immer dann, wenn mit deren Tools sich der Betrieb effizienter und reibungsloser abwickeln lässt – verglichen mit den Bordmitteln der Applikationen. Das bedeutet für die Dritthersteller, dass sie immer einen Schritt voraus sein müssen. Sie müssen erkenn, wo die Standardlösung von Microsoft Verbesserungen braucht. Doch Hersteller wie Microsoft schließen diese Lücken in ihrem Angebot immer wieder, so dass sich eine regelrechte Spiralbewegung ergibt. An dieser Tendenz wird sich in nächster Zeit auch nichts ändern.
Rainer Huttenloher
Mehr zum Thema Exchange publiziert Tony Redmond in Englisch auf seinem Blog.